Eintauchen in die russische Provinz der Gegenwart. Maxim Ossipow versucht sich in der Tradition Tschechows an Erzählungen des russischen Lebens, gesammelt im Band Nach der Ewigkeit (Hollitzer). Ob er an das große Vorbild herankommt und die Gegenwart so akkurat einfangen kann?
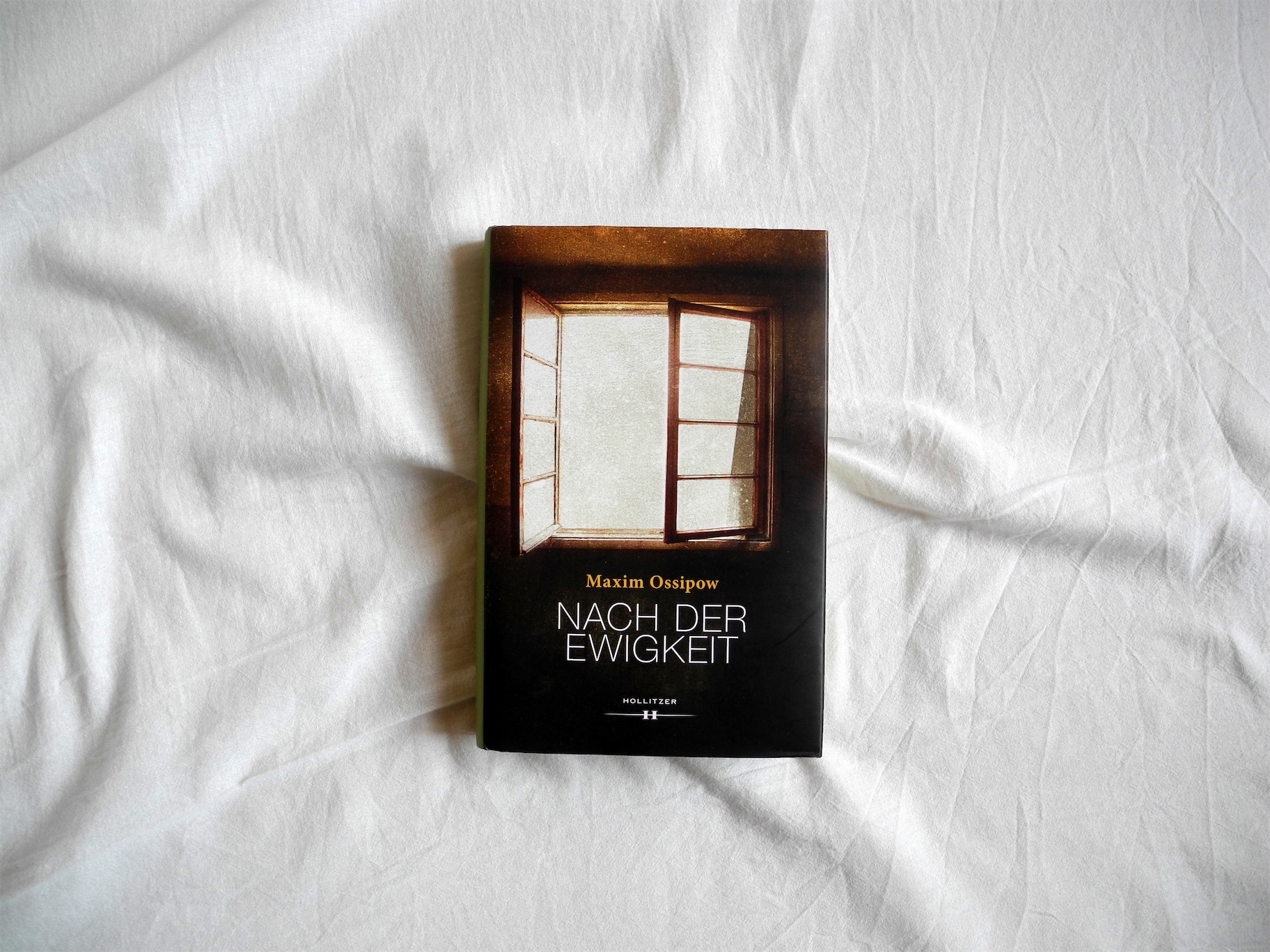
Ich werde wahrscheinlich die russische Literatur, zumindest diejenige des 19. Jahrhunderts, auf ewig mit meiner späteren Jugend verbinden. Mit ungefähr Anfang 20 habe ich alle großen und kleineren Romane von Dostojewskij verschlungen und dazu noch ein wenig Turgenjew und Gogol gelesen. Bei Puschkin habe ich zumindest noch reingeschnuppert. Dass ich dabei Namen wie Tolstoi, Pasternak oder Tschechow komplett ausgelassen habe, kann ich mir im Nachhinein nicht mehr wirklich erklären. Außer vielleicht damit, dass ich zu dieser Zeit eben sehr exzessiv einzelne Schriftsteller las und eher wenige Seitenblicke machte.
Später habe ich immer mal wieder Versuche gestartet, mich der russischen Literatur wieder anzunähern, mit nur mäßigem Erfolg. Lem war mir zu unliterarisch, Bulgakow zu ausufernd, Solschenitzyn komplett unzugänglich irgendwie. Allein Nabokov hat mir wirklich gefallen. Und Olga Grjasnowa, aber die kann man wohl nicht zur russischen Literatur zählen. Immerhin traf sie aber mit Der Russe ist einer, der Birken liebt mal wieder diesen besonderen Nerv, wenn auch aus ganz anderer Richtung.
Nun also Maxim Ossipow mit seinem Erzählungsband Nach der Ewigkeit. Zum ersten Mail seit Langem wieder ein Band aus der russischen Provinz. Und ganz nebenbei auch zum ersten Mal ein Buch aus dem Wiener Hollitzer Verlag, der mir bis dahin noch komplett unbekannt war. Herstellerisch ist das Ganze solide, allerdings mit etwas eigenartigen Entscheidungen. Die Schrift wirkt angesperrt, irgendwie zu weit und dadurch am Anfang schlecht lesbar. Und dass Cover und bedruckter Einband komplett gleich aussehen ist meiner Meinung nach reine Verschwendung. Aber das nur am Rande.
Denn entscheidend ist hier der Inhalt, und der hat mich wirklich gepackt. Die zweite Erzählung, »Moskau – Petrosawodsk«, trifft wieder genau den Nerv, den einst vor allem Gogol und Turgenjew bei mir mit ihrem lakonisch-realistischen Blick auf die russische Provinz getroffen haben. Die ruhige, meist zurückgenommene und wenig deutende Erzählweise konnte mich gleich wieder abholen; hier mit einem Ich-Erzähler, sonst meist aus der typischen dritten Perspektive. Ossipows Prosa hat mich so sehr zurückversetzt, dass ich bei der Erwähnung eines Handys erst mal vollkommen verwirrt war.
Denn – und das finde ich hier so bemerkenswert – würde man die diversen technischen Hilfsmittel und Errungenschaft der letzten 150 Jahre hier rausstreichen, wären wir fast ohne Abstriche wieder mit Turgenjew unterwegs. Gescheiterte Existenzen, Kleinkriminelle, Dorfpatriarchen und -matriarchinnen bevölkern die Erzählungen wie einst. Es wird die Etikette zelebriert, Höflichkeit wie Sport betrieben, gleichzeitig aber auch gesoffen, gepöbelt und betrogen, was das Zeug hält. Im Unterschied zu den alten Erzählern liegt aber hier oft eine schwere Trauer, oder vielmehr eine große Enttäuschung über den Zusammenbruch der Sowjetunion auf vielen, vor allem den gescheiterten Figuren. Eine interessante Parallele zum deutschen postsozialistischen Befinden.
Moskau – Petrosawodsk: eine Zugfahrt von ganzen vierzehneinhalb Stunden. Fast immer nerven einen die Mitreisenden: mit ihrem Bier, dem Dörrfisch, billigem Cognac »Bagration« oder »Kutusow«, anfangs mit Offenheit, dann mit Aggression. Wir fahren los, alles in Ordnung, noch bin ich alleine im Abteil. […] Auf einmal erscheinen zwei Typen. Auf den letzten Drücker. Belegen die unteren Plätze. Sitzen da und atmen. Verflucht.
Ossipows Ton gleicht dem der großen russischen Erzähler in vielen Passagen so sehr, dass technische Mittel immer wieder wie Fremdkörper wirken – aber man gewöhnt sich dann doch schnell daran, dass es hier um die russische Gegenwart geht. So erweitert sich auch der Kreis der Themen auf Felder wie Auswanderung in die USA, das Leben der Neureichen, alternde KGB-Spione und ihre ehemaligen Familien im Westen.
Leider hält Nach der Ewigkeit die Spannung nicht lange genug aufrecht. Zumindest mir ging es nach der ersten Hälfte so, die ich wirklich gerne gelesen und mich an den Schilderungen des russischen Lebens ergötzt habe. Das Interesse war irgendwann weg. Vielleicht liegt es daran, dass die meisten Erzählungen auf keine Pointe oder ähnliches zulaufen, nicht kunstvoll gerundet sind, sondern vielmehr ein Stück des Weges mit ihren Figuren gehen. Oder es lag an meiner anfänglichen Faszination, der Freude des Wiederentdeckens, die später einer gewissen Ernüchterung weichen musste. Oder auch einfach an der Tatsache, dass es Erzählungsbände bei mir traditionell etwas schwerer haben, wie auch schon Saša Stanišićs Fallensteller.
So bietet Maxim Ossipows Erzählungsband Nach der Ewigkeit einen erfrischenden Einblick in das russische Gegenwartsleben, vor allem in der Provinz. Er erinnert damit an die großen russischen Erzähler und bringt deren lakonische Sprache ins 21. Jahrhundert. Leider können nicht alle Erzählungen diese durchaus hoch gehängte Latte überspringen. Die Übersetzung von Birgit Veit erscheint mir aber durchweg absolut ordentlich.
Hollitzer Verlag
333 Seiten | 25,– Euro
Erschienen im Februar 2018
* Dies ist ein Affiliate-Link. Falls du ihn anklickst und dich danach für den Kauf des Buches auf Genialokal entscheidest, unterstützt du nicht nur den unabhängigen Buchhandel, sondern auch uns. Wir erhalten eine kleine Provision, für dich bleibt der Preis des Buches natürlich immer gleich.

