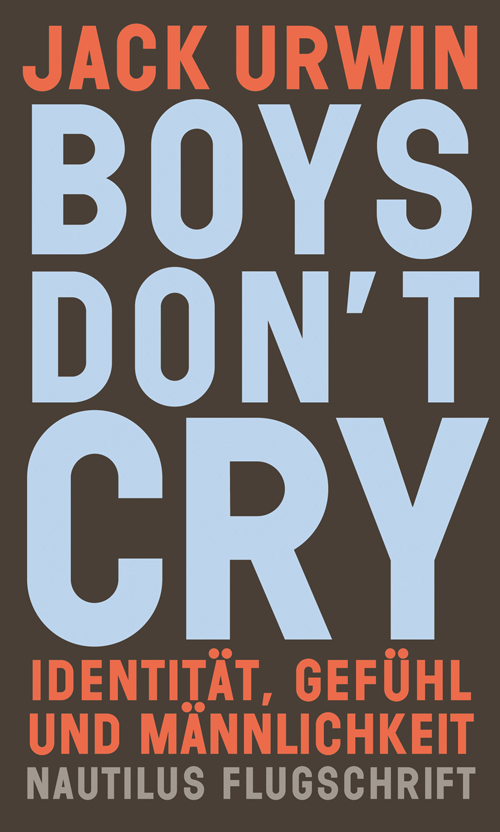Männlichkeit und deren Auswüchse in sich ändernden Zeiten gehören zu den weiterhin unterschätztesten Problemen der Gegenwart. Boys don’t cry von Jack Urwin ist praktisch schon ein aktueller Klassiker, der das ändern möchte. Mal wieder: Pflichtlektüre!
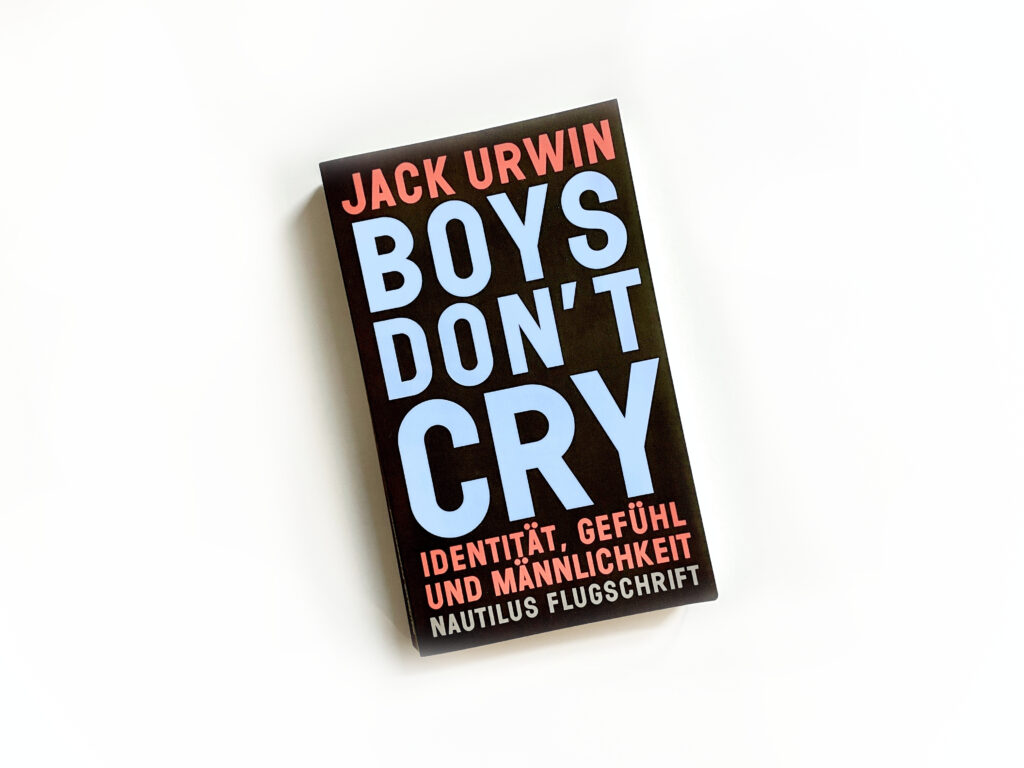
Es gibt derzeit global so viele Problemfelder, dass man schnell den Überblick verliert. Ungleichverteilung von Reichtum und Lebenschancen, Klimakrise, Vertreibung, Armut, Hunger … you name it. Dabei bleiben in der Betrachtung von oben, die Nachrichten und sonstige Berichterstattung im Normalfall wählen, tiefer liegende Phänomene und Komplexe meist unbeachtet. Ein Komplex, der zwar in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, aber immer noch unterrepräsentiert scheint in Anbetracht seines Zerstörungspotenzials, ist Männlichkeit.
Natürlich wird nicht alles Schlechte in der Welt von Männern begangen oder ausgelöst, und natürlich sind Männer an sich nicht schlecht oder einfach pauschal schuld an den globalen Krisen unserer Zeit (und der Vergangenheit). Aber ein großer Teil der rechtslastigen globalen Elite sind und waren zweifellos Männer, und leider ist das Konzept von Männlichkeit in einer patriarchalen Welt auch für Frauen, die Erfolg haben möchten, alles andere als irrelevant. Und lässt man mal die großen Probleme weg und schaut ins Kleine, dann bleibt Männlichkeit gerade in seinen fragilen, angegriffenen oder sich bedroht fühlenden Formen ein Faktor, der weltweit Gesellschaften aushöhlt und für Gewalt, Ungleichheit und Leid sorgt – nicht nur bei Frauen, Homosexuellen, trans Personen und anderen nicht dem heteronormativen Mainstream zugehörigen Gruppen.
Pioniere der Männlichkeitsforschung in Deutschland, wie beispielsweise Klaus Theweleit, verfolgen meist einen eher akademischen Ansatz. Das ist gut und richtig, versperrt aber für viele den leichten Zugang zu einem ziemlich komplexen Thema. Jack Urwin geht in Boys don’t cry komplett anders vor. Er erzählt essayistisch aus seinem eigenen Leben, von seinem Vater und seinem Großvater, beide tief in der britischen working class verhaftet – so wie Urwin selbst auch. Von diesem Punkt aus erläutert er, wie sich die Männlichkeit in Folge der Umstellung von Industrie auf Dienstleistungen in der westlichen Welt seit den 1960er Jahren immer mehr ihrer Identifikationsgrundlage, der schweren körperlichen Arbeit, die eine ganze Familie ernähren konnte und an die es keine weiteren Fragen gab, beraubt sehen.
Viele toxische Aspekte moderner Männlichkeit können wir bis dahin zurückverfolgen. Bei allem Negativen, das wir mit den alten Traditionen verbinden, verhalfen diese Männern doch zu einer gewissen gesunden Bekräftigung ihrer Männlichkeit. Auch ohne sie brauchten Männer aber das Gefühl, sich als Männer fühlen zu können, und leider musste das jetzt aus ihrem Verhalten und ihrer Haltung kommen. Toxische Männlichkeit in ihrer grundlegendsten Ausprägung ist nichts anderes als aus Unsicherheit geborene Überkompensation: eine übertriebene Zurschaustellung von Verhaltensweisen und Handlungen, die man als männlich erachtet.
Das tradierte Konzept des »starken Mannes«, der Frau und Kinder hat, diese durch seine schwere Arbeit ernährt und so eine ehrenwerte Familie anführt, ohne sich selbst dabei gesellschaftlich oder emotional zu sehr einbringen zu müssen, steht also seit dem auf der Kippe. Das Muster wird aber immer noch als Ideal hochgehalten, (irgendwie) gelebt und immer noch an Kinder weitergegeben. In seiner ausgehöhlten Form braucht es jedoch stetig neue Ersatzhandlungen, um einen Identifikationskern wiederherzustellen. Hier kommen dann Gewalt, Macht und Bedrohungen ins Spiel – und es wird toxisch, und das noch mehr, da die neue Arbeitswelt Frauen plötzlich (zumindest theoretisch) die gleichen, oft sogar bessere Chancen gewährt als Männern, die schon in der Schule dem »coolen« Männlichkeitscode folgten und lieber gesoffen haben, als einen Abschluss zu machen.
Urwin behandelt in Boys don’t cry alle Aspekte der Männlichkeit von der Sozialisierung im Kindesalter über die Sexualität, Feindlichkeit gegenüber Andersartigen, Feindlichkeit gegenüber sich selbst und natürlich einem völlig übersteigerten Körperkult. Er mischt dabei eine journalistische Herangehensweise, die vor allem Einzelgeschichten interviewartig einbringt, mit eher theoretischen Teilen, versucht aber den leichten Ton immer zu halten. Mir waren die O-Töne meist ein bisschen zu ausführlich, da hätte es gern weniger sein können. Auch das Thema Militär kam mir heillos überrepräsentiert vor, auch wenn das Urwin als Brite, der nun in Kanada lebt, wohl ganz anders sehen dürfte, da das Militär dort viel präsenter ist als in Deutschland. Das sind aber nur kleine Makel an einem ansonsten großartigen Buch.
Denn was Boys don’t cry schafft, ist nicht nur, betroffenen Personen mehr über sich oder ihnen nahestehenden Menschen zu eröffnen. Es weitet auch den Blick auf Bewegungen gekränkter Männlichkeit, wie wir sie in Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus, aber auch im Konservatismus und natürlich auch – aber vielleicht besser versteckt – in den linken Parteien und Bewegungen beobachten können. Es zeigt ein klein wenig, was die Welt erreichen könnte, wenn die eine Hälfte besser mit sich selbst klarkommen würde. Und leider auch, dass das noch ein gutes Stück Weg sein wird.